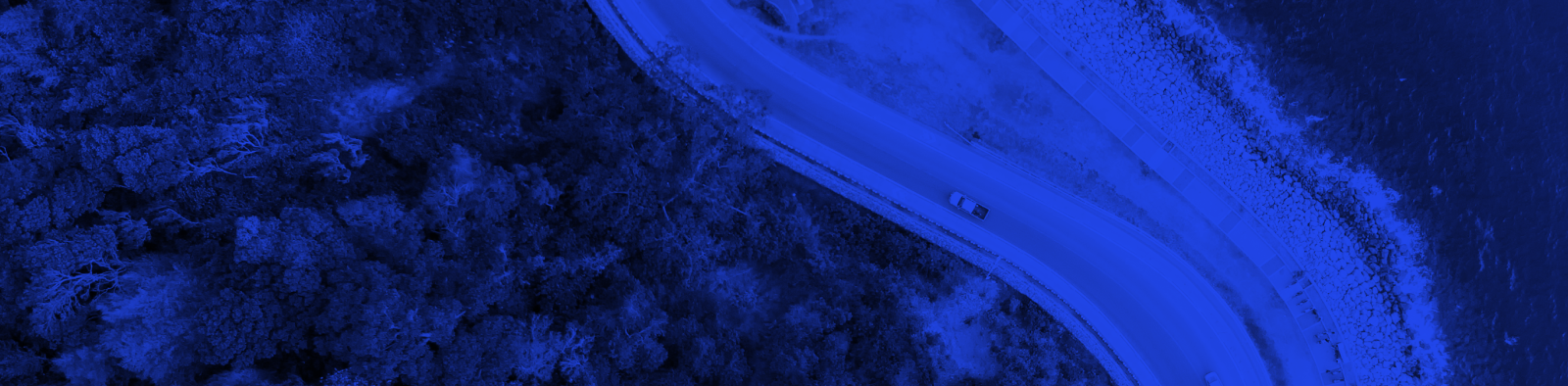Die UEFA hingegen nimmt dieses Thema sehr ernst. Ihre ESG-Strategie wird durch datenbasierende Fakten gestützt – von Klimapolitik bis hin zu nachhaltiger Infrastruktur – mit dem Ziel, dass die EURO 2024 zum Nachhaltigkeitsmaßstab für die Ausrichtung großer Sportveranstaltungen wird. Laut Michele Uva, UEFA-Direktor für soziale und ökologische Nachhaltigkeit, wird sie „Teil der Lösung sein, um die Auswirkungen des Fußballs auf die Umwelt zu messen und zu reduzieren“.
Aber wie kann eine solch große Sportveranstaltung mit Hunderttausenden von Fans, die nach Deutschland reisen, um ihr Land anzufeuern, überhaupt nachhaltig sein? Wir werden untersuchen, wie Organisatoren die Umweltauswirkungen eines Turniers durch Daten, Transparenz und Zusammenarbeit reduzieren können.
Die Aufwärmphase: Alte Stadien, Interrailing und schottische Fans
Infrastruktur: Stadien
Für die EM 2024 wurden keine neuen Stadien gebaut, um die Emissionen der Infrastruktur so weit wie möglich zu begrenzen. Dies steht in starkem Kontrast zum CO₂-Fußabdruck der sechs permanenten Stadien, die für die Weltmeisterschaft 2022 gebaut wurden. Deren Gesamtemissionen im Zusammenhang mit ihrem Bau wurden auf 1,6 Mio. tCO2e geschätzt. Dies ist etwa dreimal so viel wie für die gesamte EURO 2024 prognostiziert wird.
Allerdings hat Deutschland mit den bereits vorhandenen Weltklasse-Stadien einen beträchtlichen Heimvorteil, da für deren Vorbereitung auf die EM nur relativ wenig vonnöten war.
Wenn potenzielle Gastgeber oder Co-Gastgeber keine bestehenden Stadien haben, die den Infrastrukturvorschriften der UEFA entsprechen, kann und sollte Nachhaltigkeit von Anfang an in jedes neue Stadionprojekt integriert werden. Die Planung der Infrastruktur mit weniger Materialien und höherer Effizienz, die Suche nach emissionsärmeren Materialalternativen und die Verwendung von emissionsärmeren Brennstoffen im Bauprozess sind zentrale Bereiche für potenzielle Turnierausrichter.
Energieverbrauch am Spieltag
Es gibt natürlich kein Patentrezept, um Emissionen einer Großveranstaltung wie der EM 2024 zu vermeiden. Allerdings können sie durch eine Kombination von Maßnahmen effektiv reduziert werden. Darunter zählen Abfall- und Wassermanagementsysteme, effiziente Lichtanlagen und, wo es geographisch möglich ist, die Energieversorgung vor Ort.
Das Ziel, das Vereine und Organisatoren anstreben sollten, ist der Bezug von 100% erneuerbarer Energie, die nach Möglichkeit vor Ort erzeugt wird. In einigen Stadien auf der ganzen Welt wird dies bereits umgesetzt. Dazu zählt auch die geplante 2,4-MWp-Solaranlage des SC Freiberg auf dem Dach des Europa Parks, die zweitgrößte ihrer Art weltweit.
Fan-Reisen
Das Öko-Institut hat prognostiziert, dass die EURO 2024 ungefähr 490.000 tCO2e verursachen wird. Der Transport trägt mit knapp 70% davon am meisten dazu bei.
Es ist unvermeidbar, dass Fans, die aus der ganzen Welt zu einem solchen Sportereignis anreisen, einen großen CO2-Fußabdruck hinterlassen. Um diese Auswirkungen zu verringern, sollte vor allem die Nutzung von Bahn und Bus gegenüber dem Auto und dem Flugzeug stimuliert werden.
Zur EM wird die kostenlose Nutzung des Nahverkehrs für 36 Stunden für die 2,8 Millionen Spieltagstickets, sowie stark ermäßigte Intercity- und internationale Zugtickets angeboten. Dies wird die mit der Anreise der Fans verbundenen Emissionen während des Turniers erheblich reduzieren. Die Reduzierung der Emissionen von Fans, die aus ihren Heimatländern aus ganz Europa anreisen, ist allerdings eine größere Herausforderung.
Im ersten Aufeinandertreffen spielt Gastgeber Deutschland gegen Schottland in der Allianz Arena in München. Deutsche Fans, die mit dem Zug zu dem Eröffnungsspiel reisen und somit die kostenlose Anreise am Spieltag nutzen, produzieren im Durchschnitt nur 41 gCO2e pro Fahrgast. Für die gegnerischen Fans ist dies etwas komplizierter.
Es wird erwartet, dass bis zu 200.000 schottische Fans die Reise nach München antreten, wobei nur 10.000 von ihnen Eintrittskarten für das Spiel haben. Das Öko-Institut hat in seinen Schätzungen lediglich 9.000 zusätzliche Fans berücksichtigt, was eine erhebliche Lücke bei den erwarteten Emissionen im Zusammenhang mit den Fans im und außerhalb des Stadions hinterlässt. Aus Kosten- und Zeitgründen werden diese zusätzlichen Fans trotz vergünstigter internationaler Bahnreisen wahrscheinlich mit dem Flugzeug von Schottland nach Deutschland reisen, was sich auf etwa 83.000 tCO2e für die Hin- und Rückreise beläuft.
Derartige verborgene Emissionen müssen berücksichtigt werden, um ein klares Bild des CO2-Fußabdrucks einer solchen Veranstaltung zu erhalten. Die nationalen Fußballverbände müssen hierfür enger zusammenarbeiten und noch ehrgeizigere Anreize für weniger emissionsintensive Reisen setzen. Dazu könnten weitere Preisnachlässe und ein größeres Angebot an internationalen Zug- und Busreisen gehören.
Die 90 Minuten: Biokraftstoff, umweltbewusste Trikots und Bratwurst
Mannschaftsreisen
Der Mannschaftstransport am Spieltag hat eine wichtige symbolische Bedeutung für ein klimaschonendes Turnier. Die EURO 2024 wurde so geplant, dass möglichst wenige Reisen anfallen. In Zusammenarbeit mit dem Sponsor Deutsche Bahn wurden spezielle Vereinbarungen getroffen, damit die Nationalmannschaften zu den Spielen mit der Bahn anreisen können. Anders als bei der EM 2016 in Frankreich, bei der von mehr als 72 Mannschaftsreisen über 75% mit dem Flugzeug erfolgten, geht die UEFA davon aus, dass bei der EM 2024 nur 25% der Mannschaften zu ihren Gruppenspielen fliegen werden.
Allerdings haben lediglich Deutschland, die Schweiz und Portugal sich verpflichtet, überhaupt nicht zu ihren Gruppenspielen zu fliegen und dies, obwohl die Anreise mit der Bahn oder Bus jene Emissionen um 95% reduzieren könnte. Dies zeigt, wie wichtig es ist, unsere führenden Fußballmannschaften zum Klimaschutz zu bewegen.
Fußballteams internationaler Ligen können und sollten auf Kurzstreckenflüge verzichten. Es werden bereits kleine Schritte unternommen, z. B. hatte sich das niederländische Team Ajax dafür entschieden, zu einem europäischen Auswärtsspiel gegen Lille im Jahr 2019 den Zug zu nehmen. Dies ist jedoch eher eine Ausnahme als die Regel, und es ist ein grundlegender Wandel erforderlich, um die Emissionsquelle von Inlandsflüge der Spitzenklubs zu bekämpfen.
Spielkleidung
Auch die Trikots, die unsere Mannschaften und Fans tragen, können ein Zeichen für einen positiven Wandel setzen. Hierbei spielen die von den Trikothersteller gewählten Materialien eine wichtige Rolle. Ein Trikot aus Polyester, wie es die meisten modernen Fußballtrikots sind, hat einen doppelt so großen CO₂-Fußabdruck wie ein Baumwolltrikot. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass wir Frenkie de Jong oder Florian Wirtz in absehbarer Zeit in einem Baumwolltrikot spielen sehen werden, da die Umstellung der bestehenden Lieferketten auf nachhaltigere Modelle sehr komplex ist.
Fußballteams und Trikothersteller können sich z.B. von den Jacken der japanischen Olympiamannschaft inspirieren lassen. Bei diesen sind Etiketten integriert, auf welchen die 8,8 kgCO2e angegeben sind, die bei der Produktion freigesetzt werden. Da EU-Richtlinien zunehmend verlangen, dass Nachhaltigkeitsangaben objektiv und unabhängig verifiziert werden, sollten Fußballvereine dem Beispiel Japans folgen, indem Fanartikeln klar und transparent gekennzeichnet werden.
Wie bei allen Kleidungsstücken ist jedoch die Reduzierung der Produktion unweigerlich der effizienteste Weg, um Emissionen, sowie Abfall zu vermeiden. Würden die Nationalmannschaften ihre Trikots zeitlich aufeinander abstimmen, um mehr als ein Turnier abzudecken, würde dies ihre Umweltauswirkungen erheblich verringern. Auf Vereinsebene ist das Problem noch akuter, da bei Spitzenmannschaften jedes Jahr Heim-, Auswärts-, Drittliga- und Trainingstrikots ersetzt werden. Ein mehrjähriges Modell würde sowohl die Anzahl der gekauften Trikots als auch die mit dem Merchandising verbundenen Emissionen reduzieren.
Verpflegung
Eine emissionsreduzierte Ernährung beruht auf einem erhöhten Anteil pflanzlicher Lebensmittel. Die UEFA wird über den genauen Prozentsatz der vegetarischen und veganen Optionen, die während der EM ausgegeben werden, als Teil der Klimabilanz nach dem Turnier berichten. Es wird geschätzt, dass jeder Fan pro Spiel 0,7 kgCO2e in Lebensmitteln und Getränken zu sich nehmen wird.
Wichtig ist, dass die Emissionen von Lebensmitteln und Getränken mit dem Energiebedarf vor Ort zusammenhängen, der durch die Zubereitung, Lagerung und Verteilung entsteht. Damit machen die Emissionen von Lebensmitteln und Getränken fast 10% aller Emissionen aus, die in den „Fanzonen“ entstehen können.
Um Emissionen zu senken, bevor der Ball ins Rollen kommt, können Zulieferer die potenziellen Auswirkungen von Lebensmittelverlusten in der Lieferkette ermitteln. Derzeit werden hier um ein Drittel der Lebensmittel verschwendet. Auch Einwegartikel sollten durch wiederverwendbare Alternativen oder Pfandrückgabesysteme ersetzt werden, und biologisch abbaubare Artikel auf dem richtigen Weg entsorgt werden. Eine klare Kennzeichnung der Emissionen von Lebensmitteln kann Verbraucher:innen helfen, sich bewusst für weniger CO₂-intensive Produkte zu entscheiden, z.B. indem gezeigt wird, dass eine vegane Bratwurst 30% weniger Emissionen erzeugt als eine herkömmliche Schweinebratwurst.
Abseits des Spielfelds: UEFAs Klimafonds und Emissionsmanagement
Um den CO₂-Ausstoß abseits des Spielfelds zu reduzieren, wird für jede Tonne an CO2-Emissionen, die bei der EURO 2024 entstehen, 25 Euro in den Klimafond eingezahlt. Prognosen vor dem Turnier lassen darauf schließen, dass sich dieser Betrag auf etwa 7 Millionen Euro belaufen wird.
Mit diesen Mitteln werden Umweltprojekte unterstützt, die von Amateurfußballvereinen in ganz Deutschland verwaltet werden und sich auf Energie, Wasser, Abfallmanagement und intelligente Mobilität beziehen.
Diese Initiative spiegelt das Engagement der UEFA wider, unvermeidbare Emissionen durch Klimainvestitionen zu bekämpfen. Sie unterstützt auch die Entwicklung eines nachhaltigkeitsbewussten Breitenfußballs.
Die Verwendung eines CO₂-Preises für lokale Klimaprojekte stellt ein geringeres Risiko dar als eine Gesamtinvestition in den Markt für Emissionsausgleiche. Die UEFA leistet hier Pionierarbeit für eine umfassende Emissionsbewertung nach dem Turnier, die auf der Vorab-Klimastudie des Öko-Instituts basiert. Diese öffentlich zugängliche Datenerhebung ist ein Novum bei großen Sportveranstaltungen und stellt eine wichtige transparente Ressource für die zukünftige Veranstaltungsplanung dar. Durch die Verknüpfung der Spieltagstickets mit den öffentlichen Verkehrsnetzen sind auch genaue Daten für Bereiche wie den Fantransport verfügbar.
Ein erheblicher CO₂-Fußabdruck, der durch den Transport von Fans, Spieler:innen, Merchandise und Unternehmen entsteht, ist bei der EM 2024 unvermeidlich. Aber die Anstrengungen zur Umsetzung tatsächlicher Maßnahmen zur Emissionsreduzierung, die durch hochwertige Daten und eine strukturierte Ausrichtung auf die wichtigsten Emissions-Hotspots unterstützt werden, sind maßgeblich. Das gilt auch für die Verpflichtung der UEFA, im Rahmen von Race to Zero, bis 2040 Net Zero zu erreichen, was auf transparenten Aktionsplänen und robusten kurzfristigen Zielen basiert.
Fußball ist ein Teamsport und die Reduzierung von Emissionen bei großen Sportveranstlatungen muss es auch sein. Nationalmannschaften, Vereine und Dachverbänden tragen alle die Verantwortung, aufzuklären und zu handeln. Sie müssen zusammenarbeiten, um den Übergang zu Net Zero zu beschleunigen und gleichzeitig die vereinende Kraft internationaler Sportvereranstaltungen wie der EURO 2024 zu bewahren.